Der Mayerhof
Lesedauer: 4 Minuten
Versteigert, abgebrochen, ein neuer Hof entstand
Im Laufe der Jahrhunderte sind immer wieder einmal Häuser von Hofgütern abgebrannt und wurden wieder neu aufgebaut oder auch nicht. Andere wurden versteigert und abgerissen, wozu der Mayerhof im Prinschbachtal gehört. An seinem ursprünglich Standort ist nicht mehr allzu viel von dem einst dem großen Bauernhaus zu sehen. Vom Haus selbst eigentlich gar nichts mehr. Heute befindet an der Stelle ein kleiner Rastplatz mit „Zeitzeugen“ aus jenen Tagen, wo einst noch das Leben auf dem Hof blühte.

Dazu gehört vor allem der ehemalige Hofbrunnen, der seit dem Jahre 2007 wieder frisches Wasser sprudeln lässt. Allerdings in der Schreibweise gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Vor Ort am Rastplatz wird vom Mayerhof gesprochen und dem Mayerhofbrunnen. Interessant ist, dass ein Schild auf dem Weg dorthin auf den Meyerhofbrunnen mit der Schreibweise „e“ hinweist. Fakt ist jedenfalls, alle Hofbewohner die im Familienteil des Dörlinbacher Heimatbuches (erschienen 1995) aufgeführt sind, ein „a“ und kein „e“ im Familiennamen haben.
Doch wo kommt das „e“ im besagten Hinweisschild her?! Da lohnt es sich am Rastplatz den Blick vielleicht mal nach rechts oben schweifen zu lassen. Denn dort befindet sich in den Resten der ehemaligen Gartenmauer ein Bildstock von 1807, der an das alte Prinschbacher Bauerngeschlecht erinnert. Im Sockel werden Thaddäus Mayer (1766 bis 1849) und dessen Ehefrau Maria Barbara, eine geborene Griesbaum (1768 bis 1832) erwähnt. Der Familienname ist am Bildstock mit einem „e“ eingemeißelt. Allerdings ein „y“ wiederum nicht, sondern ein „i“. Kurzum von einem Thaddäus Meier ist dort die Rede. Egal welche Schreibweise nun die richtige ist, wir halten uns hier fortan an jene mit „ay“. Dennoch wollen wir einen kleinen Exkurs in die unterschiedlichen Schreibweisen machen. So gelten im Norden der Republik überwiegend Meyer und Meier, auch im benachbarten Elsass sowie in der Schweiz. Gleiches gilt für Bayern nördlich der Donau. Südlich der Donau, in Österreich und Südtirol als auch im Württembergischen werden die Familiennamen in der Regel Maier und Mayer geschrieben. Baden wiederum bildet eine fast schon typische Ausnahme. Denn hier treten bis heute alle vier Schreibweisen vermischt auf.
Zurück zu Thaddäus Mayer & Co. im Prinschbachtal. Schon dessen Vater Johann Georg Mayer (1719 bis 1771) bewirtschaftete zusammen mit Ehefrau Catharina (1725 bis 1789) den Hof im Prinschbach. Catharina, eine geborene Eble, brachte übrigens 16 Kinder zur Welt. „Thaddä“ wie Thaddäus auch genannt wurde, war das Zweitjüngste und er war zugleich jüngster Bub. Interessanterweise war auch Thaddäs Vater der jüngste Bub von zehn Kindern. Die Großeltern Philipp Mayer (1677 bis 1750) mit Ehefrau Anna (1678 bis 1758), eine geborene Griesbaum, sind die ersten Mayers (der Opa kam aus Schweighausen) im Ort gewesen. Vermutlich hat auch Thaddäs Opa zusammen mit der Oma (sie kam vom Rothweilerhof im Durenbach) das Hofgut im Prinschbachtal, das wir als Mayerhof kennen, zum Ende des 17. Jahrhunderts aufgebaut.
Thaddä fast der letzte Mayer
Es wäre durchaus möglich gewesen, dass mit Thaddä der letzte Mayer den Hof bewirtschaftet hätte. Denn seine Frau Barbara gebar ihm zwischen 1795 und 1808 neun Töchter, aber keinen einzigen Sohn als möglicher Hofbauer. Doch die älteste Tochter Anna (1795 bis 1847) sorgte quasi für den Fortbestand der Mayers auf dem Hof, indem sie Roman Mayer (1748 bis 1808), Sohn eines Tagelöhners aus dem Prinschbach, zum Mann nahm. Als viertes von insgesamt 13 Kindern kam Johann Georg im April 1821 zu Welt. Er sollte zugleich dann wirklich der letzte Mayerhofbauer sein. Er heiratete Maria Anna Offenburger (Jahrgang 1831 / Sterbejahr nicht bekannt) mit der er 12 Kinder hatte, das letzte wurde allerdings im Januar 1871 tot geboren. In jenen Jahren hatte die Familie ohnehin kein Glück, sie hatten rund 10.000 Gulden Schulden und verloren daher kurz zuvor ihren Hof. Daraufhin zogen sie nach Lahr. Das Hofgut war bereits am 8. März 1870 für 13.500 Gulden an die Evangelische Kirchenschaffnei Rheinbischofsheim gegangen. Doch das Aus für das einst 134 Morgen und 283 Ruten umfassende Hofgut stand dennoch unmittelbar bevor. Schon im Jahre 1872 wurde das mächtige Bauernhaus samt Fruchtspeicher sowie dem dazugehörigen Back-, Wasch- und Brennhaus auf Abriss versteigert. Der damalige Löwenwirt Wilhelm Rösch (1824 bis 1906) ersteigerte das Hofgebäude für 500 Gulden. Für Rösch war das aus dem abgerissenen Mayerhof gewonnene Baumaterial mehr als willkommen. Denn damit baute er den Kasperseppenhof im Durenbach auf.
Veröffentlicht am 18. Juni 2023 / red
Visuelle Impressionen zur Geschichte:
Das könnte Dir auch gefallen:
Ein Juwel am Unterrain
Wenn man im Ort von „s' Ratschriebers“ spricht dürfte nicht gleich jedem klar sein, wer damit gemeint sein könnte. Manch einer beziehungsweise manch eine dürfte...


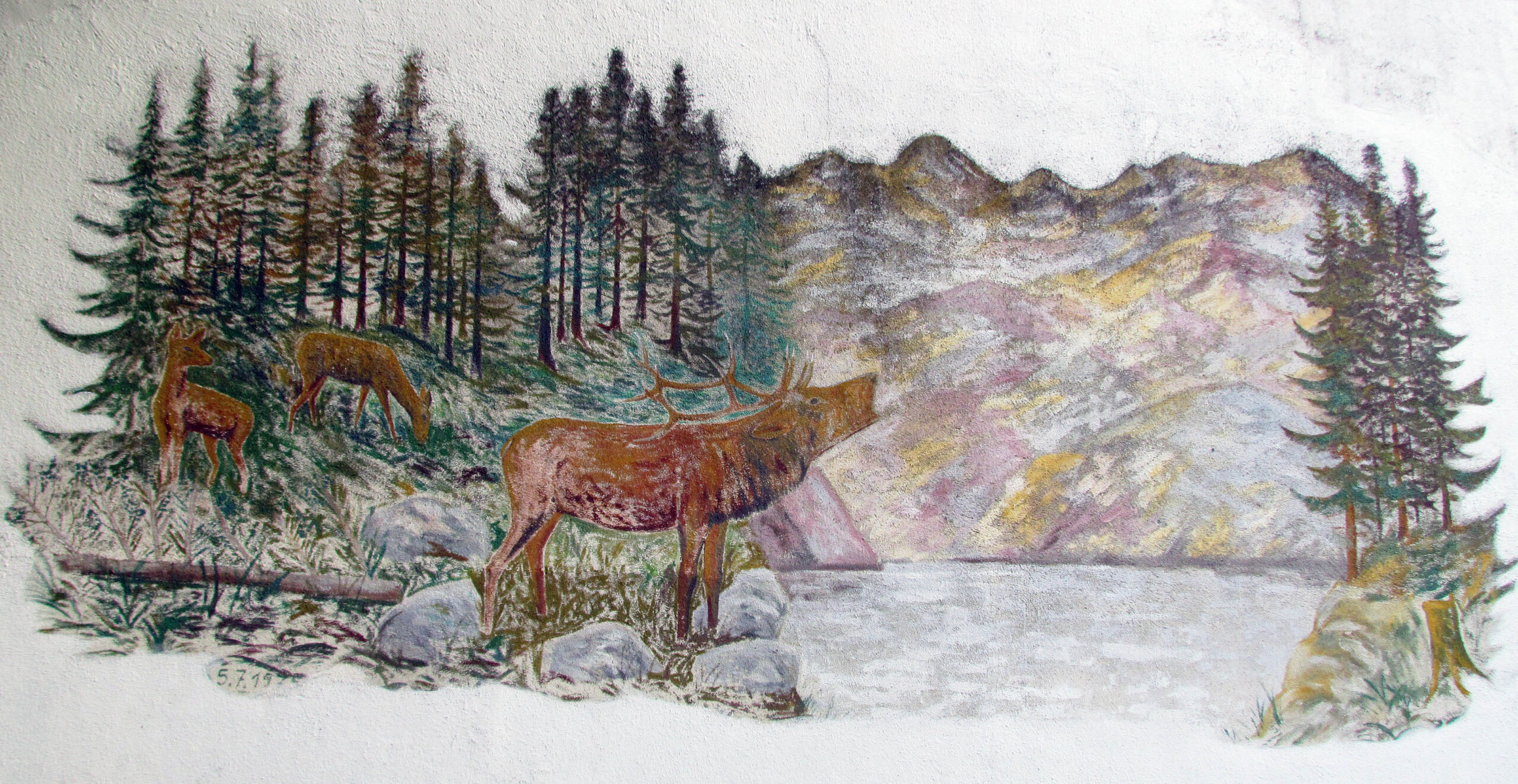












0 Kommentare